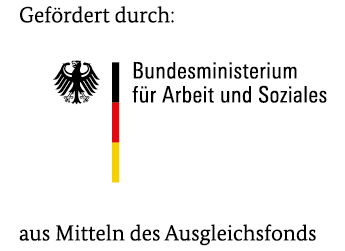Wörterbuch
Auf dieser Seite finden Sie Erklärungen zu wichtigen Begriffen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Inklusion.
Die Wörter sind alphabetisch geordnet.
Wenn Sie auf „mehr Infos“ klicken, sehen Sie die Erklärungen zu den jeweiligen Begriffen.
Haben Sie einen Begriff auf unserer Internetseite entdeckt, der im Wörterbuch noch fehlt?
Schreiben Sie gerne eine E-Mail an info@ki-kompass-inklusiv.de.
A
AI Act, Algorithmus, Augmented Reality (AR), Avatar
AI Act
Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer größere Rolle im Arbeitsalltag sowie zuhause im privaten Bereich. Um klare Regeln und einen einheitlichen Rahmen den Einsatz von KI in der Europäischen Union zu schaffen, hat das Europäische Parlament und der Rat der 27 EU-Mitgliedsstaaten am 13. Mai 2024 mit der KI-Verordnung (auf Englisch AI Act genannt) das weltweit erste Regelwerk für KI verabschiedet. Seit dem 2. Februar 2025 gelten gemäß der KI-Verordnung bestimmte Regelungen für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen. So sollen alle Personen, die im Auftrag des Arbeitgebers KI betreiben oder nutzen, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Mit dieser und einigen weiteren Ausnahmen gilt die KI-Verordnung ab dem 2. August 2026.
Die KI-Verordnung reguliert KI-Systeme, um Vertrauen in die Technologie zu schaffen, die Akzeptanz für die Technologie zu steigern und europäische Innovationen zu ermöglichen. KI darf weder missbraucht werden noch die Grundrechte verletzen; gleichzeitig sollen Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft gefördert werden.
Die KI-Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz: je höher das Risiko des KI-Systems, desto strenger sind die Vorgaben.
Weitere Informationen: s. Blogbeitrag zur KI-Verordnung
Quelle: nach Die Bundesregierung
Algorithmus
Ein Algorithmus ist eine feste Abfolge von Schritten, um ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu erledigen. Er funktioniert wie eine Anleitung oder ein Rezept, das Schritt für Schritt sagt, was zu tun ist. Computer nutzen Algorithmen, um Daten zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen oder Berechnungen durchzuführen. Ein Beispiel ist eine Suchmaschine, die mit einem Algorithmus die besten Ergebnisse für eine Anfrage findet. Algorithmen sind überall im Alltag zu finden, z. B. in Apps, Navigationssystemen oder Empfehlungssystemen.
Quelle: nach Bundeszentrale für politische Bildung
Augmented Reality, kurz AR
Augmented Reality (AR) bedeutet erweiterte Realität. Das kann durch Smartphones, Tablets oder AR-Brillen geschehen, die virtuelle Objekte über die reale Umgebung legen. Ein bekanntes Beispiel ist Pokémon GO, bei dem Pokémon in der echten Welt auf dem Bildschirm erscheinen. AR wird in vielen Bereichen genutzt, z. B. in Spielen, Navigation, in der Bildung und Industrie. Das Ziel von AR ist, die Realität mit nützlichen oder unterhaltsamen digitalen Informationen zu ergänzen.
Quelle: nach Gabler Wirtschaftslexikon
Avatar
Ein Avatar ist eine digitale Figur oder ein Bild, das eine reale Person in der virtuellen Welt darstellt. Er kann ein einfaches Profilbild, eine Comic-Figur oder ein 3D-Charakter in Videospielen oder virtuellen Welten sein. Menschen nutzen Avatare, um sich beispielsweise in Spielen oder sozialen Netzwerken zu präsentieren. Manche Avatare sehen realistisch aus, andere sind fantasievoll oder stilisiert. Der Avatar hilft, in digitalen Umgebungen mit anderen zu interagieren, ohne das eigene echte Aussehen zeigen zu müssen.
Quelle: nach informationsethik.net
B
Barrierefreiheit, Bedarfsanalyse, Berufliche Rehabilitation, Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke, Bias
Barrierefreiheit
„Barrierefreiheit bedeutet sinngemäß: für jeden begehbar, nutzbar, erreichbar. Der Begriff ist im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) definiert. Demnach sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche dann barrierefrei, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“
Quelle: REHADAT
Bedarfsanalyse
Eine Bedarfsanalyse untersucht, was in einer bestimmten Situation von einer festgelegten Gruppe benötigt wird. Dafür nutzen Forscher*innen verschiedene Methoden wie beispielsweise Fragebögen und Interviews. Im Projekt KI-Kompass Inklusiv geht es darum, wie Menschen mit Behinderungen KI-Assistenzsysteme in Bildung und Arbeit nutzen können. Die Forscher*innen fragen diese Menschen, welche Unterstützung sie brauchen. So finden sie heraus, wie KI-Systeme gestaltet werden müssen, um möglichst hilfreich und zugänglich zu sein.
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
Berufliche Rehabilitation, kurz: Berufliche Reha
„Unter Beruflicher Rehabilitation versteht man Leistungen, die Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben (wieder) ermöglichen bzw. vereinfachen sollen (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) gemäß §§ 49 SGB IX i. V. m. den jeweiligen Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger). Dazu gehören beispielsweise auch Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, eine berufliche Aus- oder Weiterbildung oder berufsvorbereitende Maßnahme wie der Erwerb einer Grundausbildung. Neben Menschen mit Behinderungen können in Deutschland auch von Behinderung bedrohte Menschen Anspruch auf Leistungen der beruflichen Rehabilitation haben.“
Quelle: REHADAT
Berufsbildungswerke, kurz: BBW
„Berufsbildungswerke (BBW) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation im Sinne des § 51 SGB IX. In Berufsbildungswerken können junge Menschen mit Behinderungen eine berufliche Erstausbildung oder Berufsvorbereitung absolvieren – dabei handelt es sich um eine sogenannte außerbetriebliche Ausbildung. Angestrebt wird ein Ausbildungsabschluss. Im BBW werden auch Maßnahmen zur Erprobung und Förderung der Ausbildungsreife oder Berufsreife angeboten.“
Weitere Informationen: s. Webseite BAG BBW
Quelle: REHADAT
Berufsförderungswerke, kurz: BFW
„Berufsförderungswerke (BFW) sind überbetriebliche Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Sie sind Ansprechpartner für alle Erwachsenen, die sich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nach Krankheit, Unfall oder aus gesundheitlichen Gründen beruflich neu orientieren müssen. Sie unterstützen erwachsene Menschen mit Weiterbildungs- und Umschulungsangeboten bei der Wiedereingliederung ins Berufsleben.“
Weitere Informationen: s. Webseite Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke
Quelle: Projekt KI.ASSIST
Bias
Bias bezeichnet eine systematische Verzerrung durch Voreingenommenheit. Voreingenommenheit sind zum Beispiel Vorurteile. Auch in KI-Systemen können verzerrte Ergebnisse vorkommen. Das passiert, wenn die Trainingsdaten einer Künstlichen Intelligenz (KI) menschliche Voreingenommenheit enthalten und dadurch den KI-Algorithmus verzerren. Das führt wiederum dazu, dass KI-Systeme verzerrte Ergebnisse und potenziell schädliche Resultate wie beispielsweise unfaire oder diskriminierende Entscheidungen ausgeben. Verzerrungen verringern die Genauigkeit von KI-Systemen und damit ihr Potenzial. Es ist wichtig, das zu wissen, wenn man ein KI-System nutzt.
Quelle: nach IBM Deutschland
C
Chatbot
Chatbot
Ein Chatbot ist ein Computerprogramm, das menschliche Kommunikation nachahmt. Er interagiert in natürlicher Sprache über Text oder Sprachausgabe.
Der Chatbot kann einfache, vorgegebene Antworten nutzen oder mithilfe von Künstlicher Intelligenz dazulernen und schwierigere Anfragen verstehen.
Chatbots werden häufig im Service für Kund*innen eingesetzt.
Quelle: nach IBM Deutschland
D
Datenbrille, Datenschutz, Datensicherheit, Datensouveränität, Digitale Transformation, Digitalisierung, Digitalkompetenz
Datenbrille
Datenbrillen sind intelligente Computersysteme, die digitale Informationen direkt ins Sichtfeld der Nutzer*innen projizieren. Sie funktionieren wie kleine Computer, die am Kopf getragen werden und mit Augen und Händen gesteuert werden. Mit integrierten Kameras, Displays und Sensoren können Datenbrillen Umgebungsdaten verarbeiten. Man unterscheidet zwischen VR-Brillen (Virtual Reality) und AR-Brillen (Augmented Reality).
Mit VR-Brillen tauchen Nutzer*innen vollständig in eine computergenerierte, virtuelle Welt ein. Sie werden vor allem für Gaming, Simulationen oder virtuelle Erlebnisse genutzt.
AR-Brillen erweitern die reale Welt, indem sie digitale Inhalte wie Texte, Grafiken oder Objekte ins Sichtfeld der Nutzer*innen projizieren. Die Umgebung bleibt sichtbar und virtuelle Elemente werden darübergelegt. AR-Brillen finden Anwendung in Bereichen wie Wartung, Schulung oder Marketing.
Lesen Sie auch die Erklärungen zu den Begriffen Virtual Reality und Augmented Reality.
Dieser Text wurde vom Projektteam zum Teil mit Unterstützung durch KI erstellt und anschließend sorgfältig redaktionell überarbeitet.
Quelle: nach Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
Datenschutz
Datenschutz sorgt dafür, dass persönliche Informationen geschützt sind und nicht ohne Erlaubnis gesammelt, bearbeitet oder weitergegeben werden dürfen. Ziel ist es, die Privatsphäre jeder Person zu schützen. Der Begriff Datenschutz umfasst alle Gesetze, die darauf abzielen, den Missbrauch von Daten durch Dritte zu verhindern.
Quelle: nach datenschutzexperte
Datensicherheit
Datensicherheit umfasst alle technischen Maßnahmen zum Schutz jeglicher Daten – nicht nur personenbezogener – und ist ein zentraler Bestandteil der IT-Sicherheit. Ihre Hauptziele sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten. Zur Umsetzung dienen technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), wie sie z. B. im Bundesdatenschutzgesetz (§ 9 BDSG) geregelt sind. Dazu zählen unter anderem Zutritts-, Zugriffs- und Eingabekontrollen sowie Maßnahmen zur Trennung und Verfügbarkeit von Daten.
Quelle: nach datenschutz.org
Datensouveränität
Der Begriff Datensouveränität überschneidet sich mit digitaler Souveränität und Datenschutz, muss jedoch klar abgegrenzt werden. Datensouveränität bedeutet eine verantwortungsvolle Gestaltung informationeller Freiheit im Umgang mit großen Datenmengen (Big Data) und soll ein zentrales ethisches und rechtliches Ziel sein. Dabei geht es nicht darum, den bestehenden Datenschutz zu schwächen, sondern Personen mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über ihre Daten zu geben. Kritik am Begriff, er diene lediglich wirtschaftlichen Interessen und der Absenkung von Datenschutzstandards, wird vom Ethikrat zurückgewiesen.
„Im Vorgängerprojekt KI.ASSIST wurde Datensouveränität als Teil der digitalen Souveränität verstanden, welche für eine Person dann gegeben ist, wenn vier Leitlinien erfüllt werden: Wahlfreiheit, Selbstbestimmung, Selbstkontrolle und Sicherheit. Diese Leitlinien können wiederum durch die drei Handlungsfelder Technologie, digitale Kompetenzen und Regulierungen gesteuert und beeinflusst werden.“
Quelle: Projekt KI.ASSIST
Digitale Transformation
Digitale Transformation beschreibt den laufenden Wandel, der durch den Einsatz digitaler und KI-basierter Technologien in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen ausgelöst wird. Betroffen sind dabei verschiedene Ebenen – wie Gesellschaft, Unternehmen oder einzelne Personen – sowie Bereiche wie Arbeit, Bildung, Kommunikation oder Gesundheit. Diese Veränderungen beeinflussen sich oft gegenseitig: Technische Neuerungen können Erwartungen und Verhalten von Menschen verändern, was wiederum Auswirkungen auf Organisationen und Strukturen hat. Ein Beispiel für digitale Transformation ist das Smartphone, das sowohl die alltägliche Kommunikation als auch die Arbeitswelt stark verändert hat.
Quelle: nach Projekt KI.ASSIST
Digitalisierung
Der Begriff Digitalisierung kann auf unterschiedliche Art und Weise verstanden werden. Nach der technischen Interpretation bedeutet Digitalisierung einerseits, dass Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherform überführt werden und andererseits, dass Aufgaben, die bisher vom Menschen übernommen wurden, auf den Computer übertragen werden. Heute wird Digitalisierung häufig – etwas breiter – mit der Einführung digitaler Technologien in Unternehmen und als Treiber der digitalen Transformation gleichgesetzt.
Quelle: nach Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik
Digitalkompetenz
Digitalkompetenz beschreibt die Fähigkeit, digitale Technologien und Medien sicher, verantwortungsvoll und zielgerichtet in Alltag, Ausbildung und Beruf zu nutzen. Sie zeigt sich darin, dass Menschen Informationen gezielt suchen, kritisch bewerten, sinnvoll speichern und organisieren können. Ebenso gehört dazu, sich über digitale Kanäle verständlich und respektvoll auszutauschen, gemeinsam an digitalen Inhalten zu arbeiten sowie eigene Beiträge zu erstellen, zu präsentieren und zu veröffentlichen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der bewusste und sichere Umgang mit persönlichen Daten und digitalen Risiken. Digitalkompetente Menschen sind in der Lage, digitale Werkzeuge zur Lösung von Problemen einzusetzen, technische Herausforderungen zu bewältigen und passende Anwendungen auszuwählen. Außerdem können sie die Wirkung digitaler Medien einschätzen, reflektieren und verantwortungsvoll damit umgehen.
Ziel ist es, Menschen dazu zu befähigen, aktiv an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben und sich selbstbestimmt in der digitalen Arbeitswelt zurechtzufinden.
Lesen Sie auch die Erklärungen zum Begriff KI-Kompetenzen.
Quelle: nach BAG BBW Leitfaden Digitale Kompetenzen
Dieser Text wurde vom Projektteam mit Unterstützung durch KI erstellt und anschließend sorgfältig redaktionell überarbeitet.
E
Ethik, Ethics by Design, Evaluation
Ethik
Ethik ist ein Begriff aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie: Nachdenken über das richtige Verhalten. Ethik ist eine Wissenschaft und beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen gut und richtig handeln können. Sie versucht, allgemeingültige Regeln und Maßstäbe zu finden, nach denen man beurteilen kann, ob ein Verhalten moralisch gut oder schlecht ist. Diese Regeln sollen allen Menschen Orientierung bieten. Sie helfen dabei, Entscheidungen zu treffen und zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Durch ethische Regeln wird klar, welches Verhalten erwünscht ist, was erlaubt ist – und was man besser unterlassen sollte.
Quelle: nach Deutscher Ethikrat
Ethics by Design
„Ethics by Design bedeutet, dass ethische Überlegungen und Wertemaßstäbe – wie Nachhaltigkeit, Ressourcen, Kinder- und Jugendschutz, Datensparsamkeit oder Herstellungs- und Handelsbedingungen – bereits bei der Entwicklung und Entstehung von Technologien und Geschäftsmodellen mitgedacht werden.“
Quelle: Bayerische Landeszentrale für neue Medien
Evaluation
Evaluation bedeutet, dass man systematisch und mit Hilfe von Daten prüft, wie gut bestimmte Maßnahmen, Abläufe oder Konzepte funktionieren. Ziel ist es, herauszufinden:
- Was genau wurde umgesetzt?
- Wie wurde es umgesetzt?
- Welche Wirkung wurde erzielt?
Im Projekt KI-Kompass Inklusiv werden die Projektangebote wie beispielsweise die Beratungen wissenschaftlich evaluiert, um einen hohen Qualitätsstandard sicherzustellen. Dafür werden regelmäßig interne Erhebungen und eine externe Evaluation durchgeführt.
Quellen: nach Uni Lübeck, Projekt KI-Kompass Inklusiv
F
Filterblase, Fokusgruppe
Filterblase
Eine Filterblase entsteht, wenn Algorithmen Informationen so auswählen, dass sie zu den vermuteten Meinungen, Interessen oder Vorlieben einer Person passen. Vor allem in sozialen Netzwerken ist das der Fall – sie sind so programmiert, dass man sich dort wohlfühlt und gerne Zeit verbringt. Deshalb sehen Nutzer*innen oft Inhalte, die ähnlich sind wie das, was sie sich schon zuvor angeschaut haben. Diese Inhalte sprechen sie meistens an, weil sie zum eigenen Geschmack passen. So bekommen Menschen häufig ähnliche Texte, Bilder oder Videos angezeigt. Alles, was nicht dazu passt, wird herausgefiltert – und genau das führt zur sogenannten Filterblase.
Quellen: nach Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache und Bundeszentrale für politische Bildung
Fokusgruppe
Unter einer Fokusgruppe versteht man eine Form der Gruppendiskussion, die zum Beispiel in der qualitativen Sozialforschung sowie in der Marktforschung eingesetzt wird. Es handelt sich um eine moderierte Diskussion mehrerer Teilnehmer*innen, welche sich meist an einem Leitfaden orientiert. Aufgrund des Leitfadens mit offenen Fragen spricht man auch von einem teilstandardisierten Interview. Daher ist auch von Fokusgruppen-Interviews die Rede.
Quelle: marktforschung.de
G
Gamification
Gamification
Gamification leitet sich von dem englischen Begriff „Game” ab, das „Spiel“ bedeutet. Unter Gamification versteht man die Integration von Spielelementen in spielfremde Umgebungen. Das können Arbeitsplätze, Schulen, Online-Communitys oder auch Bewerbungsprozesse sein. Mittels Gamification sollen unangenehme, langweilige oder auch sehr schwierige Aufgaben spielerisch zugänglicher gemacht werden. Im Zuge der Digitalisierung hat das Konzept eine starke Verbreitung erfahren. Bei Gamification geht es um mehr als nur um Ranglisten und Punkte. Es geht um die Frage, was Menschen generell zum Handeln motiviert.
I
Importeur, Inklusion, Inklusives Design
Importeur
Ein Importeur führt Güter in das Inland ein oder veranlasst dies. Güter können dabei Waren, Software oder auch KI-Technologien sein. Sobald KI-Technologien auf dem europäischen Markt in den Verkehr gebracht, also angeboten und genutzt werden, müssen sie den Vorgaben der KI-Verordnung (AI Act) entsprechen. Das gilt auch für KI-Technologien, die aus dem nicht-europäischen Ausland auf den EU-Markt kommen.
Quelle: nach Gabler Wirtschaftslexikon
Inklusion
Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhalten soll, sich umfassend und gleichberechtigt an der Gesellschaft zu beteiligen. Die Teilhabe darf nicht von Faktoren wie individuellen Fähigkeiten, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder Alter abhängen. Vielfalt wird als normal vorausgesetzt. Daher gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, um Inklusion beispielsweise von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.
Quelle: nach Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Inklusives Design
Inklusives Design berücksichtigt die Vielfalt und Einzigartigkeit der Nutzer*innen von Produkten und Dienstleistungen. Inklusion wird dabei im gesamten technischen Entwicklungsprozess mitgedacht, denn eine Ergänzung um diesen Aspekt im Nachhinein ist nur sehr schwer umzusetzen. Die Grundidee ist, Produkte so zu gestalten, dass sie von möglichst vielen Menschen ohne jegliche Einschränkung benutzt werden können. Die Nutzer*innen sollen sich nicht an das Produkt anpassen müssen. Inklusives Design denkt nicht in kleinen Zielgruppen, für die Lösungen entwickelt werden müssen, sondern setzt auf einen möglichst breiten Zugang, der der gesellschaftlichen Vielfalt Rechnung trägt.
Quelle: nach anti-bias.eu
K
Künstliche Intelligenz (KI), KI.ASSIST, KI-gestützte Assistenzsysteme, KI-Kompetenzen, KI-Verordnung, Kompetenzzentrum
Künstliche Intelligenz, kurz: KI
Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet von Menschen entwickelte Systeme, die – unter Berücksichtigung eines komplexen Ziels – in der physischen oder digitalen Welt agieren. Sie tun dies, indem sie ihre Umgebung wahrnehmen, die gesammelten strukturierten oder unstrukturierten Daten interpretieren, auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse Schlussfolgerungen ziehen und die besten Maßnahmen (gemäß vordefinierter Parameter) zur Erreichung des gegebenen Ziels auswählen.
KI-Systeme können auch so konzipiert sein, dass sie aus ihren Handlungen lernen. Sie analysieren, wie sich ihre vorherigen Handlungen auf die Umgebung auswirken und passen ihr Verhalten entsprechend an.
Als wissenschaftliche Disziplin umfasst KI mehrere Ansätze und Techniken, unter anderem:
- maschinelles Lernen (einschließlich spezieller Methoden wie Deep Learning und Reinforcement Learning)
- maschinelles Schlussfolgern (dazu gehören Planung, Terminierung, Wissensrepräsentation und -verarbeitung, Suche und Optimierung)
- Robotik (einschließlich Steuerung, Wahrnehmung, Sensorik und Aktorik sowie die Integration aller anderen Techniken in cyber-physische Systeme).
Quelle: nach High-Level Expert Group on Artificial Intelligence
KI.ASSIST
KI.ASSIST ist das Vorgängerprojekt von KI-Kompass Inklusiv. Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus Mitteln des Ausgleichsfonds geförderte Projekt lief von April 2019 bis März 2022 und erforschte den Einsatz KI-gestützter Assistenzsysteme für Menschen mit Schwerbehinderung in der beruflichen Rehabilitation.
Die vier Projektpartner haben systematisch, wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert untersucht, welche Personengruppen an welchen Lern- und Arbeitsorten nachhaltig von KI-gestützten Assistenzsystemen profitieren können. Dabei stand der Mensch mit seinen individuellen Bedarfen im Fokus.
Quelle und weitere Informationen: Projekt KI.ASSIST
KI-gestützte Assistenzsysteme
Assistenzsysteme für Teilhabe am Arbeitsleben sind Systeme, die Menschen mit (drohenden) Behinderungen bei Bildungs- und Arbeitsprozessen unterstützen, um vorhandene Fähigkeiten zu bewahren, zu verbessern oder zu erweitern.
Digitale Assistenzsysteme sind „rechnergestützte Systeme, die Menschen zum Beispiel bei der Informationsaufnahme (Wahrnehmung), Informationsverarbeitung (Entscheidungsfindung) und Arbeitsausführung unterstützen” (Link & Hamann, 2019).
Wenn diese Systeme Methoden Künstlicher Intelligenz wie z. B. Maschinelles Lernen oder Natürliche Sprachverarbeitung verwenden, werden sie als „KI-gestützte Assistenzsysteme“ bezeichnet (Feichtenbeiner & Beudt, 2022).
Quellen: Einsatz digitaler Assistenzsysteme in der Produktion, KI.ASSIST
KI-Kompetenzen
Der Begriff KI-Kompetenzen wird in der KI-Verordnung (AI Act, Art. 3 Nr. 56) definiert und bezeichnet die Fähigkeiten, die Kenntnisse und das Verständnis, um KI-Systeme sachkundig, verantwortungsvoll und sicher einzusetzen. Zudem soll man sich der Chancen und Risiken (z.B. ethisch, rechtlich, gesellschaftlich) von KI bewusst sein.
Seit dem 2. Februar 2025 gelten gemäß der KI-Verordnung bestimmte Regelungen für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen. So sollen alle Personen, die im Auftrag des Arbeitgebers KI betreiben oder nutzen, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen.
KI-Kompetenzen können beispielsweise durch folgende Inhalte aufgebaut werden:
- grundlegendes Verständnis von Daten und KI (z.B. Begriffe, Chancen und Risiken von KI-Systemen)
- fortgeschrittene KI-Kompetenzen (z.B. technische Aspekte der angewendeten KI, rechtliche Einordnung des angewendeten KI-Systems)
- rollenspezifische Trainings mit individuellen Schwerpunkten (z.B. Technik, Recht, Ethik)
Beim Kompetenzaufbau können folgende vier Grundsteine unterstützen:
- Individuellen Bedarf ermitteln (z.B. Welche Personen entwickeln, betreiben oder nutzen welche KI-Systeme zu welchem Zweck und mit welchen Risiken?)
- Maßnahmen ausgestalten inkl. Berücksichtigung von individuellen Faktoren (z.B. Ausbildung, Erfahrung, Art der Tätigkeit), vom Kontext, in dem das KI-System eingesetzt wird, des Risikos, der Rolle der eigenen Organisation.
- Regelmäßige Auffrischung von KI-Kompetenzen (z.B. neue Anwendungsfelder durch technologische Entwicklungen)
- Durchgeführte Maßnahmen ausreichend dokumentieren (Art der Maßnahme, Umfang, teilnehmende Personen)
Quelle: Nach Bundesnetzagentur
KI-Verordnung
Die KI-Verordnung (EU) 2024/1689 wurde am 13. Juni 2024 vom Europäischen Parlament und dem Rat verabschiedet und legt Vorschriften für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union fest. Mit wenigen Ausnahmen gilt sie ab dem 2. August 2026. Mehr Informationen finden Sie unter dem Begriff AI Act.
Dieser Text wurde vom Projektteam mit Unterstützung durch KI erstellt und anschließend sorgfältig redaktionell überarbeitet.
Quelle: nach AI-Act
Kompetenzzentrum
Ein Kompetenzzentrum ist eine spezialisierte Einrichtung oder Organisation, die Fachwissen, Ressourcen und Expertise in einem bestimmten Themenbereich bündelt. Sie dient als zentrale Anlaufstelle für Beratung, Forschung, Entwicklung, Wissenstransfer und Qualifizierung.
Im Rahmen des Projekts KI-Kompass Inklusiv wird ein Kompetenzzentrum für KI-gestützte Assistenztechnologien und Inklusion im Arbeitsleben aufgebaut. Das Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen an der digitalen Transformation und den Potenzialen Künstlicher Intelligenz aktiv zu beteiligen.
Das Kompetenzzentrum bietet umfassende Informations-, Beratungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote, die speziell auf Menschen mit Behinderungen, Fachkräfte der beruflichen Rehabilitation und Unternehmen ausgerichtet sind. Zu den Kernaktivitäten des Kompetenzzentrums gehören Fachveranstaltungen, Schulungen, Workshops und ein auf der Projektwebseite verfügbarer Wissenspool zu ethischen und datenschutzrechtlichen Fragestellungen, der Implementierung sowie der Finanzierung von KI-gestützten Assistenzsystemen in der Arbeitswelt.
Das bundesweite Angebot des Kompetenzzentrums ist ortsunabhängig und großenteils virtuell verfügbar. Dadurch ist es flexibel und für eine breite Zielgruppe zugänglich.
Quelle: KI-Kompass Inklusiv
L
Lern- und Experimentierräume (LER)
Lern- und Experimentierräume, kurz: LER
Lern- und Experimentierräume (LER) sind geschützte Formate, in denen Unternehmen, Beschäftigte und Sozialpartner innovative Ansätze für die Arbeitswelt der Zukunft entwickeln und erproben können.
Im Projekt KI.ASSIST wurden LER speziell für Menschen mit Behinderungen und Fachkräfte der beruflichen Rehabilitation gestaltet, um gemeinsam KI-gestützte Assistenztechnologien zu testen. Die Gestaltung basierte auf Bedarfsanalysen, Design-Thinking-Workshops und Schulungen, um passgenaue Lösungen zu schaffen. Ein Partizipationsleitfaden unterstützte die aktive Einbindung aller Beteiligten, während eine externe Evaluation die Ergebnisse analysiert und Optimierungspotenziale aufgezeigt hat.
Quelle: Projekt KI.ASSIST
M
Machbarkeitsanalyse, Maschinelles Lernen (ML), Monitoring
Machbarkeitsanalyse
Eine Machbarkeitsanalyse prüft, ob ein Konzept umsetzbar ist. Sie bewertet technische, wirtschaftliche, politische, rechtliche und organisatorische Faktoren. Im Rahmen der Machbarkeitsanalyse für KI-Kompass Inklusiv stehen insbesondere die folgenden Schwerpunkte im Fokus, die für den Einsatz einer KI-gestützten Assistenztechnologie von Bedeutung sind:
- Verfügbarkeit und Lieferzeiten
- Kosten
- Technische Anforderungen
- Implementierungs- und Betriebsaufwand
- Datenschutz
- Ethik
- Barrierefreiheit und Anwendungsvoraussetzungen für Nutzende
Diese Kriterien sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die KI-Lösung sowohl praktisch umsetzbar als auch nachhaltig und inklusiv ist.
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
Maschinelles Lernen, kurz: ML
„Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz. Es bezeichnet Verfahren, bei denen ein Algorithmus durch Wiederholung selbstständig lernt, Aufgaben zu lösen – ohne dass der Lösungsweg vorgegeben wird. Statt festen Regeln folgt das System dem Prinzip, aus großen Datenmengen Muster und Strukturen zu erkennen und sein Verhalten anhand eines Gütekriteriums zu optimieren. Mit jeder weiteren Datenmenge und Rückmeldung verbessert sich die Leistung des Systems. So können Maschinen aus Erfahrung lernen, komplexe Aufgaben bewältigen und sich an neue Situationen anpassen, ohne starr programmiert zu sein.“
Quelle: nach IKS Fraunhofer
Monitoring
Mit dem Monitoring wird im Projekt KI-Kompass Inklusiv „der aktuelle Stand der Entwicklungen bei KI-gestützten Assistenztechnologien für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen untersucht. Im Zentrum steht die Frage ‚Welche Produkte, welche Forschungsprojekte und welche abgeschlossenen Projekte mit Prototypen existieren bereits?‘
Ziel ist der Aufbau einer regelmäßig aktualisierten Datenbank für KI-gestützte Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderungen. Diese Datenbank liefert für die Projektbereiche Praxislabore und Beratung, aber auch für die Zielgruppen des Projekts fundierte, aktuelle Daten zum Stand der Entwicklungen und zur Verfüg- und Machbarkeit KI-gestützter Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderungen. Inhalte dieser Datenbank werden für die Zielgruppen und Stakeholder des Projekts über die Webseite im Technologie-Monitor (auf der Webseite im Bereich KI-Wissen) zugänglich gemacht.
Für das Arbeitspaket Monitoring ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) verantwortlich.“
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
N
Nudging
Nudging
Nudging bezeichnet eine Methode, mit der Menschen zu bestimmten Entscheidungen oder Verhaltensweisen angeregt werden – ohne Zwang, Verbot oder finanzielle Anreize. Wörtlich übersetzt heißt „nudge“ so viel wie „Stupser“.
Dieser Text wurde vom Projektteam mit Unterstützung durch KI erstellt und anschließend sorgfältig redaktionell überarbeitet.
O
Open-Source-Modelle
Open-Source-Modelle
Open-Source-Modelle in der Künstlichen Intelligenz (KI) zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Bestandteile öffentlich zugänglich und nachvollziehbar sind. Im Gegensatz zu klassischer Open-Source-Software umfasst das bei KI fünf zentrale Komponenten:
- den Trainingscode,
- die Trainingsdaten,
- die Testdaten,
- die Metadaten sowie
- das fertig trainierte Modell.
Nur wenn alle diese Elemente offenliegen, ist ein KI-Modell vollständig transparent und überprüfbar. Viele aktuelle Modelle großer Unternehmen erfüllen diese Kriterien nicht, was unabhängige Kontrolle und Forschung erschwert.
Quellen: nach Forschungszentrum Jülich und Working Paper des Instituts für Innovation und Technik (iit) Nr. 69
P
Partizipation, Praxislabor, Privacy by Default, Privacy by Design, Profiling, Prototyp
Partizipation
Partizipation bedeutet, dass Menschen aktiv an Entscheidungen und Prozessen teilnehmen, die ihr eigenes Leben oder ihre Gemeinschaft betreffen. Es geht dabei, nicht nur darum zu sein, sondern auch mitzureden, mitzubestimmen und mitzugestalten. Ein Beispiel ist, wenn Bürger*innen in ihrer Stadt gemeinsam über die Gestaltung eines neuen Parks entscheiden. Partizipation fördert das Gefühl der Zugehörigkeit und stellt sicher, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden.
Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Praxislabor
Praxislabore sind spezielle Projekte oder Einrichtungen, in denen neue Ideen, Technologien oder Methoden in realen Umgebungen getestet und weiterentwickelt werden. Sie dienen dazu, praktische Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, wie sich innovative Ansätze im Alltag bewähren. Ein Beispiel dafür sind die Praxislabore des Projekts KI-Kompass Inklusiv. Dort wird erforscht, wie Künstliche Intelligenz (KI) Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben unterstützen kann. In diesen Laboren arbeiten Menschen mit Behinderungen, Forscher*innen und Unternehmen zusammen, um KI-gestützte Hilfsmittel direkt am Arbeitsplatz zu erproben und weiterzuentwickeln.
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
Privacy by Default
Privacy by Default bedeutet, dass der Schutz persönlicher Daten bei digitalen Diensten standardmäßig auf dem höchsten Niveau voreingestellt ist. Nutzer*innen müssen nichts aktiv tun – ihre Daten sind automatisch bestmöglich geschützt. Erst durch bewusste Entscheidung können sie mehr Informationen freigeben. So ist Datenschutz von Anfang an integriert und unnötige Datenerhebung wird vermieden.
Quelle: nach Kähler, M. (2022). Datensouveränität, KI und Menschen mit Behinderungen. Konzepte, Analysen und Maßnahmen. Ergebnisbericht des Projekts KI.ASSIST. Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke e. V.
Privacy by Design
Privacy by Design bedeutet, dass Datenschutz von Anfang an in die Entwicklung von Produkten und Prozessen integriert wird. Schon bei der Planung werden nur notwendige Daten berücksichtigt und Schutzmaßnahmen eingebaut. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu minimieren und persönliche Daten bestmöglich zu schützen.
Quelle: nach Kähler, M. (2022). Datensouveränität, KI und Menschen mit Behinderungen. Konzepte, Analysen und Maßnahmen. Ergebnisbericht des Projekts KI.ASSIST. Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke e. V.
Profiling
Profiling im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) bezeichnet die automatisierte Sammlung und Analyse von Daten über Personen, um deren Verhalten, Vorlieben oder andere Eigenschaften vorherzusagen oder zu bewerten. KI-Systeme nutzen dabei Algorithmen, um Muster in großen Datenmengen zu erkennen und daraus Rückschlüsse auf individuelle Personen zu ziehen.
Quelle: nach Europäisches Parlament
Prototyp
Ein Prototyp ist eine Technologie, die in einem abgeschlossenen Projekt entwickelt wurde und als Vorführmodell vorliegt, jedoch (anders als ein fertiges Produkt) nicht frei am Markt verfügbar ist. Diese Unterscheidung betont, dass Prototypen zwar funktionsfähige Konzeptnachweise darstellen, aber oft noch weiterer Entwicklung bedürfen, z. B. um Zugänglichkeit und Praxistauglichkeit sicherzustellen.
Quelle: nach Projekt KI-Kompass Inklusiv
R
Rahmenbedingung
Rahmenbedingung
Im Projekt KI-Kompass Inklusiv bezieht sich das Wort Rahmenbedingungen auf alle äußeren Faktoren, die wichtig sind, um den Einsatz von KI-Assistenztechnologien zu ermöglichen. Das können zum Beispiel technische, organisatorische, rechtliche oder finanzielle Voraussetzungen sein oder den Anwendungskontext einer KI-Assistenztechnologie betreffen.
Die Rahmenbedingungen legen fest, unter welchen Bedingungen und mit welchen Ressourcen KI-gestützte Assistenzsysteme am Arbeitsplatz eingeführt werden.
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
S
Stakeholder
Stakeholder
Das Wort Stakeholder bedeutet so viel wie Interessensgruppe oder Beteiligte. Beim Einsatz von KI-gestützten Assistenzsystemen sind das alle Personen oder Organisationen, die von der Einführung dieser Systeme betroffen sind.
Beispiele für Stakeholder im Projekt KI-Kompass Inklusiv sind:
- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitgeber
- Fachkräfte der beruflichen Rehabilitation
- Kostenträger
- KI-Anbieter
Quelle: Projekt KI-Kompass Inklusiv
T
Technik-Affinität, Tool, Trainings-Daten
Technik-Affinität
Technik-Affinität ist eine Eigenschaft von Menschen.
Sie bedeutet, dass jemand Technik mag.
Die Person interessiert sich stark für Technik.
Die Person versteht Technik gut.
Zum Beispiel digitale Technologien.
Man sagt auch: Die Person ist technik-affin.
Erklärung: Projekt KI-Kompass Inklusiv mit Hilfe von capito.ai
Tool
Übersetzung: Hilfs-Werkzeug
Tool ist ein englisches Wort und wird so ausgesprochen: Tuul.
Tool meint „Hilfs-Werkzeug“.
Tools können Computer-Programme sein.
Die Computer-Programme helfen den Nutzer*innen bei ihren Aufgaben.
Zum Beispiel:
• ein online-Taschenrechner
• eine Video-Konferenz-App wie zoom
• ein Programm zum Erstellen von Umfragen
• ein Programm für die Bild-Bearbeitung
Es gibt Tools mit KI und ohne KI.
Erklärung: Projekt KI-Kompass Inklusiv mit Hilfe von capito.ai
Trainings-Daten
Trainings-Daten sind Daten.
Daten sind Informationen.
Ein Computer-Programm mit Künstlicher Intelligenz braucht diese Informationen, damit es lernen kann.
Das Computer-Programm bekommt viele Beispiele.
Das können sein:
• Bilder
• Texte
• Zahlen
Das Computer-Programm schaut sich die Daten genau an.
Es erkennt Muster und Gemeinsamkeiten.
Dann kann es später bei neuen Daten erkennen:
• Was ist das?
• Was passt dazu?
Ein Beispiel:
Das Computer-Programm bekommt viele Bilder von Tieren.
Dann erkennt es später:
Das ist ein Hund. Oder: Das ist eine Katze.
Aber: Die Daten müssen gut und fair sein.
Sonst lernt das Computer-Programm falsche Dinge.
Erklärung: Projekt KI-Kompass Inklusiv mit Hilfe von capito.ai
U
Universelles Design
Universelles Design
Universelles Design ist ein internationales Design-Konzept, das Produkte, Geräte, Umgebungen und Systeme so gestaltet, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind. Der Begriff hat seinen Ursprung in den 1980er Jahren und wurde anfangs insbesondere im Kontext der barrierefreien Architektur eingeführt.
Im Gegensatz zu Inklusivem Design wird die Gestaltung von Produkten, Gebäuden oder Dienstleistungen beim Universellen Design nicht gezielt auf die Bedürfnisse kleiner Nutzer*innengruppen hin optimiert.
Quelle: nach REHADAT
W
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
Werkstätten für behinderte Menschen, kurz: WfbM
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Sie bieten berufliche Bildung und Teilhabe für Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
Quelle: nach BAG WfbM
Z
Zwei-Sinne-Prinzip
Zwei-Sinne-Prinzip oder 2-Sinne-Prinzip
Das Zwei-Sinne-Prinzip bedeutet, dass eine Information immer auf mindestens zwei verschiedene Arten (z. B. Sehen und Hören) zugänglich sein sollte. Dadurch erhalten möglichst viele Menschen die Information.
Es hilft besonders Menschen mit Behinderungen, weil es sicherstellt, dass wichtige Informationen nicht nur über einen einzigen Sinn vermittelt werden. Aber das Zwei-Sinne-Prinzip erleichtert auch den Alltag von Menschen ohne Behinderungen. Zum Beispiel, wenn das Handy klingelt und gleichzeitig vibriert.
Quelle: nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung