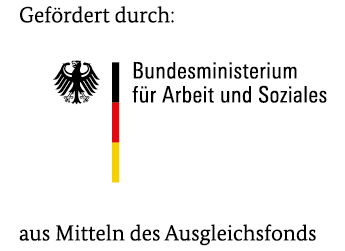Die Arbeitswelt von morgen braucht Technologien, die Barrieren überwinden und Menschen mit Behinderungen einen Zugang ermöglichen. Beim 75. Lunchtalk von “Soup & Science”, dem Podcast von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, war Dr. Berit Blanc (Senior Researcher am Educational Technology des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DKFI) und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH) zu Gast und besprach mit Moderatorin Jessica Wiener, wie Technologien, innovative Software und Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt inklusiver gestalten können.
Die ganze Folge zum Nachhören finden Sie hier: https://www.inforadio.de/
Frau Blanc, erstmal allgemein: Gleiche Chancen für alle. Ist das die Motivation Ihrer Forschung?
„Ja, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt ist ein ganz großer Faktor. Der andere Faktor ist der, dass alle über KI, über Künstliche Intelligenz sprechen und wir aus vielen Jahren der Populärkultur wissen, dass es große Ängste vor KI gibt und vor der Machtübernahme durch KI. Dass KI aber auch Potenziale hat und Menschen nicht ersetzen, sondern unterstützen soll und kann, ist eigentlich der große Motor meiner Forschung und meiner Arbeit am DFKI.“
Nun treffen ja Menschen im Rollstuhl zum Beispiel auf andere Hürden als Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen oder auch Menschen mit psychischen Einschränkungen, die man ja mitunter nicht sieht. Wie lässt sich das alles vereinen?
„Man sollte nicht so sehr von dem Behinderungsaspekt ausgehen, sondern von dem, was unterstützt werden soll. Der Fokus liegt auf den Fragen, welche Arbeit oder welche Arbeitsleistung unterstützt werden soll. Dass zum Beispiel betroffene Menschen Internetseiten durchforsten können, dass sie am Arbeitsplatz einen Halbleiter zusammenstecken können, obwohl sie eine Sehbehinderung oder eine Hörbehinderung haben oder im Rollstuhl sitzen. Es gibt da also verschiedene Arten von Aufgaben, die durch Künstliche Intelligenz unterstützt werden sollen und können.“
Das spielt alles eine Rolle bei einem Ihrer aktuellen Forschungsprojekte, das heißt KI-Kompass Inklusiv. Ziel dieses Projektes ist es, ein Kompetenzzentrum aufzubauen. Was ist damit genau gemeint?
„Dieses Kompetenzzentrum kann man sich vorstellen wie ein Haus. Man hat ein Fundament, das besteht aus der Erfahrung von Vorgängerprojekten. Wir wissen, welche Technologien es zum Beispiel schon auf dem Markt gibt, wie diese sich entwickeln, wo es Lücken gibt und welchen Bedarf es tatsächlich von Menschen mit Behinderungen oder aus der beruflichen Rehabilitationswelt gibt. Auf diesem Fundament haben wir drei Säulen:
Die zentrale Säule ist die Beratung. Wir wollen eine Beratungsstelle aufbauen, die Informationen und Schulungen bietet rund um das Thema KI-gestützte Assistenztechnologien bei der Arbeit. Dieses Beratungszentrum kann natürlich nur beraten, wenn es Erfahrungen hat.
Und diese hat sie zum einen aus der Säule Monitoring, für welche ich zuständig bin. Wir recherchieren systematisch im Internet, welche Technologien es bereits gibt und ob diese Technologien bereits als Produkte auf dem Markt sind, ob sie gerade in Projekten entwickelt werden oder ob sie noch Prototypen sind, die im schlimmsten Fall gerade irgendwo in der Schublade liegen. Wir erfassen die recherchierten Technologien in einer Datenbank mit Informationen, wie sie funktionieren, was sie unterstützen, wie barrierefrei sie sind und in welchen Sprachen sie verfügbar sind. Der Technologiemonitor ist auf unserer Website öffentlich zugänglich.
Die dritte Säule sind die Praxislabore. Dort werden ausgewählte Technologien mit verschiedenen Beteiligten, wie Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber, KI-Anbieter und KI-Forscher, ganz praktisch am Arbeitsplatz getestet und wir versuchen herauszubekommen, was nötig ist, damit so eine Technologie, die sich als hilfreich herausgestellt hat, tatsächlich auch in einem Betrieb oder in einer Reha-Einrichtung eingesetzt werden kann.
Und diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir aus dem Monitoring und in den Praxislaboren sammeln, fließen wieder in unsere Beratungssäule, in unser Beratungsteam.
In dem ganzen Projekt ist uns besonders wichtig, Partizipation und Barrierefreiheit zu leben. Das heißt, die Menschen, um die es geht, tatsächlich mit einzubeziehen, sie an Praxislaboren mitarbeiten zu lassen, unser Projekt insgesamt begleiten zu lassen und alle Produkte, wie unsere Webseite, die Informationsveranstaltungen und Schulungen, so barrierefrei zu gestalten, wie es möglich ist.“
Gibt es durch diese Beteiligung der Betroffenen im Projekt Einblicke, die Sie persönlich überrascht haben?
„Also im ersten Projekt hat mich ganz klar überrascht, wir wahnsinnig offen die betroffenen Menschen für KI sind und wie hoch ihre Frustrationstoleranz ist. Obwohl wirklich einige Technologien, wie zum Beispiel solche Avatare, die bei Bewerbungsgesprächen helfen sollen oder die Emotionsregulierung trainiert haben, nicht so wunderbar funktioniert haben und z.B. seltsame Bewegungen gemacht haben. Das Feedback der betroffenen Menschen war trotzdem: „Das hat aber ein Riesenpotenzial und ich bin offen dafür“.
Was sind denn zum Beispiel KI-gestützte Assistenztechnologien, die gut angenommen wurden und auch gut funktionieren?
„Momentan insbesondere Technologien, die bei Sehbeeinträchtigungen, Sehbehinderungen oder bei Hörbehinderungen helfen. Ein Beispiel ist ein kleines Gerät mit einer Kamera, welches man an die Brille steckt. Zusätzlich hat man ein Headset und kriegt quasi die Umgebung beschrieben. Und wenn diese Technologie auch entsprechend trainiert ist, dann kann sie auch sagen: „Frau Wiener betritt gerade den Raum.“ Das ist eine Technologie, die sehr gut bewertet wird und die auch schon seit längerem im Einsatz ist.
Andere Technologien, die zum Beispiel für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen das Gesprochene transkribieren, haben wir tatsächlich mittlerweile fast in jedem Smartphone integriert.
Dann gibt es zum Beispiel Gehstöcke bzw. Blindenstöcke, die beim Navigieren unterstützen, indem sie über verschiedene Rückkanäle vibrieren oder durch Sprachsteuerung Auskunft darüber geben, wie der Weg ist.“
Foto: KI-Kompass Inklusiv